
Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Jan. 2025 abgeschlossen.
ZR-Fachgespräch„Multimorbide ältere Risikopatienten sind eine wachsende Herausforderung!“
| Im Jahr 2030 werden in Deutschland mehr als 30 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Damit geht einher, dass auf dem zahnärztlichen Stuhl immer mehr Menschen mit Polypharmazie Platz nehmen, was die Praxis bei Maßnahmen und Verordnungen berücksichtigen muss. Insbesondere im Bereich der Schmerzmittel- und Antibiotikatherapie sowie bei der Lokalanästhesie sollte auf die vorliegenden Medikamente und Krankheiten multimorbider Patienten eingegangen werden, erläutert PD Dr. Dr. Frank Halling im ZR-Fachgespräch mit Dr. Ulrike Oßwald-Dame. |
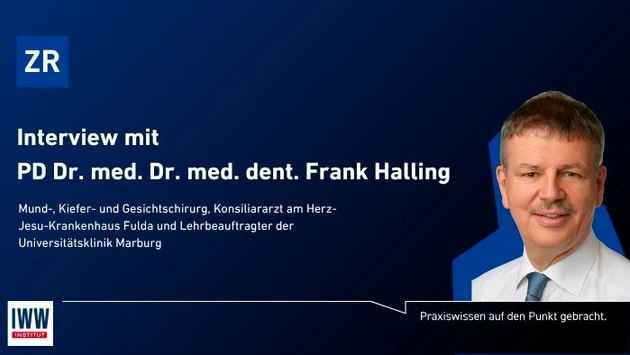
Redaktion: Herr Dr. Halling, Polypharmazie und Multimorbidität sind Begleiterscheinungen des Alters. Was bringt das mit sich und was muss die Zahnarztpraxis daraus für sich ableiten?
Halling: In der Altersgruppe der über 65-Jährigen liegt der Anteil der Patienten mit Polypharmazie, also Patienten, die regelmäßig fünf und mehr Medikamente einnehmen, bei 42 Prozent. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit von Wechselwirkungen mit der Zahl der eingenommenen Medikamente. Gerade bei älteren Patienten ist es deshalb wichtig, Komplikationen durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen und -wechselwirkungen zu vermeiden.
Es gibt verschiedene Ursachen für Probleme in der Pharmakotherapie bei älteren Patienten. Alte Menschen weisen weniger Skelettmuskeln und weniger Gesamtkörperwasser auf, d. h., der relative Wassergehalt des Körpers nimmt ab und der relative Anteil des Fettgewebes zu. Deshalb kommt es zu einer Verringerung der Verteilungsvolumina, was bei einer altersbedingten Verminderung der renalen Elimination von Arzneistoffen schnell zu Überdosierungen führen kann. So sinkt die glomeruläre Filtrationsrate bei über 70-Jährigen um 25 bis 50 Prozent. Durch die Zunahme des relativen Fettanteils am gesamten Körpergewicht besteht für lipophile Medikamente wie Ampicillin und Bupivacain ein größeres Verteilungsvolumen und damit eine längere Wirkdauer. Einschränkungen von Organfunktionen (z. B. Leber- oder Niereninsuffizienz) sind Ursache weiterer Probleme. Darüber hinaus führt das niedrigere Körpergewicht älterer Menschen zusätzlich zu einem kleineren Verteilungsvolumen und dadurch zu höheren Arzneimittelspiegeln.
Die Crux dabei: Bei älteren Patienten besteht ein eher gering ausgeprägtes Risikobewusstsein bezüglich der Gefahren einer Arzneimitteltherapie. Die zahnärztliche Praxis muss deshalb die bereits verordneten Medikamente bei ihren Verschreibungen und Maßnahmen stets im Blick haben.
Redaktion: Wie geht die Praxis dabei konkret vor. Sollte sie bspw. einen Anamnesebogen bereits zu Hause ausfüllen lassen, damit möglicherweise Angehörige oder unterstützendes Pflegepersonal auf Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben achten können?
Halling: Das wäre z. B. eine Möglichkeit. In jedem Fall ist eine eingehende Anamnese ein sehr wichtiges Instrument, das dabei hilft, das notwendige individuelle Risikoprofil eines älteren Patienten vor einer geplanten zahnärztlichen Behandlung zu erstellen. Neben den Informationen über die Grund- und Vorerkrankungen des Patienten ermöglicht eine Medikamentenanamnese die Einschätzung weiterer Risiken und damit möglicherweise auftretenden Komplikationen. Zusätzlich sollte bei multimorbiden Patienten immer eine Rücksprache mit dem betreuenden Hausarzt beziehungsweise mit weiteren behandelnden Kollegen und Kolleginnen erfolgen. Im Falle demenzieller Erkrankungen sind natürlich auch die Auskünfte der Angehörigen von besonderer Relevanz. Vielleicht kann die elektronische Patientenakte hierbei in Zukunft eine wesentliche Erleichterung für die zahnärztliche Praxis bedeuten.
Redaktion: Werden wir konkret. Ibuprofen ist das Analgetikum, was in der Zahnarztpraxis mit Abstand am meisten verordnet wird. Auf welche Wechsel- und Nebenwirkungen müssen wir hier genau schauen?
Halling: Die häufig in einer Zahnarztpraxis verschriebenen, antiphlogistisch wirksamen Analgetika (NSAR) wie Ibuprofen erhöhen alle das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Außerdem reduzieren sie die Nierenfunktion und -durchblutung sowie die Schleimbildung im Magen-Darm-Trakt, was gastrointestinale Blutungen auslösen kann. In Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmern wie Clopidogrel oder Acetylsalicylsäure, die meist dauerhaft eingenommen werden müssen, ist dieses Risiko besonders hoch. Gleiches gilt für die Kombination mit Antidepressiva aus der Gruppe der SSRI (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren), wie z. B. Citalopram, da diese selbst schon eine Thrombozytenfunktionshemmung bewirken. Da Ibuprofen über die Leber verstoffwechselt wird, ist es bei schweren Leberfunktionsstörungen, wie z. B. bei vorliegendem Alkoholismus, kontraindiziert.
Wenn Ibuprofen kurz vor der Acetylsalicylsäure (ASS) eingenommen wird, kann der in der kardialen Prophylaxe erwünschte antikoagulatorische Effekt von ASS aufgehoben oder zumindest verringert werden. Dieser Effekt tritt unabhängig von der Ibuprofendosis auf und wird bei anderen NSAR nicht festgestellt. Ob und inwieweit sich eine solche Interaktion klinisch auswirkt und ob die zeitlich versetzte Einnahme von Ibuprofen und Low-Dose-ASS diesen Effekt aufheben kann, ist derzeit noch umstritten.
Bei der Verschreibung von Paracetamol oder Metamizol ist im Vergleich zu NSAR deutlich seltener mit Interaktionen zu rechnen. Diese Wirkstoffe sollten besonders bei Patienten mit anamnestisch bekannten Schleimhautulzerationen, Magen- oder Darmgeschwüren oder chronischen Darmerkrankungen bevorzugt werden. Allerdings ist die erhöhte Lebertoxizität von Paracetamol sowie die seltene, aber lebensbedrohliche Agranulozytose in Verbindung mit der Einnahme von Metamizol zu beachten.
Redaktion: Was müssen niedergelassene Kolleginnen und Kollegen bei der Verschreibung von Antibiotika beachten?
Halling: Bekanntermaßen reduzieren Antibiotika durch Störung der Darmflora die Synthese von Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren. Patienten, die Phenprocoumon (Marcumar®) erhalten und gleichzeitig Antibiotika einnehmen, haben dadurch ein erhöhtes Blutungsrisiko. Diese Interaktion ist besonders problematisch, da sie in vielen Beipackzetteln sowie in der Roten Liste nicht erwähnt wird. Amoxicillin mit Clavulansäure geht mit einem etwa doppelt so hohen Risiko für Blutungen einher, gleichzeitig ist die Clavulansäure hepatotoxisch. Diese Kombination sollte deshalb nur bei schweren Infektionen eingesetzt werden. Die in der Zahnmedizin verwendeten Antibiotika Erythromycin, Clarithromycin und Metronidazol sind klassische Inhibitoren der Cytochrom P450-Enzyme. Diese Enzyme sind für die Metabolisierung vieler Arzneistoffe verantwortlich. Dazu gehört auch Marcumar®, dessen Blockade der Metabolisierung durch die gleichzeitige Einnahme der o. g. Antibiotika zu einer ausgeprägten Gerinnungshemmung und damit zu fatalen Blutungen führen kann. In diesen Fällen ist die situationsadaptierte Reduktion der Marcumar®-Dosis gerade bei älteren Patienten obligatorisch.
Clindamycin kann mit acetylcholinergen Rezeptoren reagieren und die nicotinerge Signalübertragung inhibieren. Dies kann in Kombination mit Muskelrelaxantien (wie Tolperison) oder Narkosegasen (wie Desfluran) zu einer übermäßigen Erschlaffung der Muskulatur und damit zu Atemnot führen.
Potenziell lebensgefährliche kardiale Arrhythmien können bei der Verordnung von Makroliden wie Erythromycin/Clarithromycin bei gleichzeitiger Einnahme von trizyklischen Antidepressiva wie Opipramol/Amitryptilin oder des SSRI Citalopram auftreten. Generell sollten aufgrund der besseren Bioverfügbarkeit und der deutlich längeren Verweildauer im Gewebe die „neueren“ Makrolide (z. B. Azithromycin) bevorzugt werden.
Redaktion: Zu den Lokalanästhetika ist wohl alles gesagt und die Bedeutung der Vasokonstringentien bei kardial vorbelasteten Patienten bekannt, oder?
Halling: Die Vasokonstriktoren, die zusammen mit Lokalanästhetika eingesetzt werden, führen häufiger zu Nebenwirkungen, z. B. zu kardiovaskulären Komplikationen, als der lokalanästhetische Wirkstoff selbst. Obwohl bekannt ist, dass bei kardial vorbelasteten Patienten Lokalanästhetika mit 1:100.000 Adrenalinzusatz nicht zum Einsatz kommen sollen, erfolgt dies in Deutschland noch immer bei über 40 Prozent. Auch kann sich die Pharmakokinetik eines Arzneistoffs durch den Vasokonstriktor verändern. U. a. kann in Kombination mit der Einnahme nicht-kardioselektiver Betablocker (z. B. Propanolol) ein erheblicher Anstieg des Blutdrucks (hypertensive Krise) und eine schwere Bradykardie auftreten. MAO-Hemmer, trizyklische Antidepressiva (z. B. Amitryptilin, Imipramin) oder Levothyroxin können den Effekt des Adrenalins verstärken, indem sie den Abbau der exogen zugeführten Katecholamine verzögern. Dies führt zu adrenalintypischen Nebenwirkungen wie kaltem Schweiß, Übelkeit, Schwindel oder Angstzuständen. Generell muss bei der Anwendung von Lokalanästhetika beachtet werden, dass Patienten mit einer Hypertonie häufig mit ACE-Hemmern, Sartanen, Kalziumantagonisten, Betablockern und/oder Diuretika medikamentös eingestellt sind und bei gleichzeitiger Gabe ein blutdrucksteigernder Effekt auftreten kann.
AUSGABE: ZR 1/2025, S. 8 · ID: 50243779
