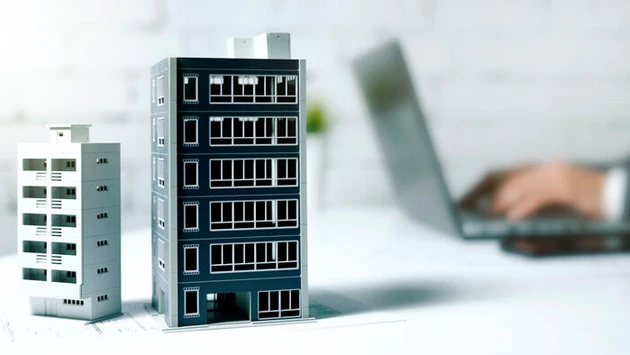Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.
VermögensübertragungenVermögensübergabeverträge richtig gestalten und Sonderausgabenabzug nicht gefährden
| Die Übertragung von Betrieben, Mitunternehmeranteilen oder bestimmten GmbH-Anteilen gegen lebenslange Versorgungsleistungen ermöglicht es, Vermögen unentgeltlich auf Angehörige zu übertragen, ohne dass stille Reserven aufgedeckt werden müssen. Mit diesem Gestaltungsmodell kann es z. B. gelingen, ein Familienmitglied als Betriebsnachfolger einzusetzen, der die zu erbringenden Versorgungsleistungen dann auch steuermindernd als Sonderausgaben abziehen kann. Dieser Abzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG setzt allerdings nicht nur den Abschluss eines entsprechenden Vermögensübergabevertrags voraus, es müssen auch einige wichtige „Spielregeln“ eingehalten werden. |
1. Problemstellung
Die steuerrechtliche Anerkennung derartiger Übertragungsverträge setzt voraus, dass die gegenseitigen Rechte und Pflichten klar und eindeutig sowie rechtswirksam vereinbart und ernsthaft gewollt sind. Darüber hinaus müssen die Leistungen auch wie vereinbart tatsächlich erbracht werden. Als wesentlicher Inhalt des Übertragungsvertrags müssen der Umfang des übertragenen Vermögens, die Höhe der Versorgungsleistungen und die Art und Weise der Zahlung vereinbart sein (BFH 15.7.92, X R 165/90, BStBl II 1992, 1020). Die Vereinbarungen müssen zu Beginn des durch den Übertragungsvertrag begründeten Rechtsverhältnisses oder bei Änderung dieses Verhältnisses für die Zukunft getroffen werden.
Merke | Änderungen der Versorgungsleistungen sind steuerrechtlich nur anzuerkennen, wenn sie durch ein i. d. R langfristig verändertes Versorgungsbedürfnis des Berechtigten und/oder die veränderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verpflichteten veranlasst sind. Rückwirkende Vereinbarungen werden grundsätzlich steuerrechtlich nicht anerkannt, es sei denn, die Rückbeziehung ist nur von kurzer Zeit und hat lediglich technische Bedeutung (BFH 21.5.87, IV R 80/85, BStBl II 1987, 710; 29.11.88, VIII R 83/82, BStBl II 1989, 281). |
Von besonderer Wichtigkeit ist, dass die vereinbarten Versorgungsleistungen in den Folgejahren auch vertragsgemäß erbracht werden. Hierauf achtet die Finanzverwaltung insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen, denn ein vertragswidriges Verhalten i. S. v. Nichtzahlung oder nur teilweiser Zahlung gefährdet die steuerliche Anerkennung der nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG begünstigten Vermögensübergabe ggf. auch dann für die Zukunft, wenn der Vermögensübernehmer wieder zur vertragsgemäßen Zahlung zurückkehrt. Allerdings ist nicht jede Abweichung von den vertraglich getroffenen Vereinbarungen als steuerschädliches Verhalten zu werten. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die hierzu ergangene Rechtsprechung zu werfen.
2. Von der Rechtsprechung als noch unschädlich sanktionierte Umstände
Werden Versorgungsleistungen verspätet, aber in vereinbartem Umfang erbracht, ist dies für sich allein betrachtet unschädlich. Denn die Art und Weise der Zahlung der Versorgungsleistungen ist nur eines von mehreren Kriterien. Sie kann daher nicht allein den Ausschlag für oder gegen die Anerkennung des Versorgungsvertrags geben. Allerdings fließt sie in die Gesamtschau ein und kann mit weiteren Indizien darüber Aufschluss geben, ob die Parteien einen Rechtsbindungswillen besitzen (BFH 15.10.10, X R 10/09, BFH/NV 11, 581).
Beachten Sie | Entsprechendes gilt, wenn vereinbarte Zahlungen reduziert werden, sofern es sich um eine einvernehmliche und nur vorübergehende Reduzierung handelt, die sich an dem Versorgungszweck des Vertrags orientiert. Im Streitfall wurden die unbaren Versorgungsleistungen wie geschuldet erbracht und lediglich die Barzahlungen in Absprache mit den Empfängern um ca. die Hälfte gekürzt (BFH 15.10.10, X R 31/09, BFH/NV 11, 583). Für das Gericht war darin keine willkürliche Nichtbeachtung der vertraglichen Pflichten zu sehen.
Dem Abzug von Versorgungsleistungen muss auch nicht entgegenstehen, dass eine vertraglich vereinbarte Erhöhung des bar zu zahlenden Teils der Altenteilsleistungen, die zum 65. Lebensjahr des Berechtigten vorgenommen werden soll, unterbleibt, weil sie schlicht vergessen wurde (BFH 16.6.21, X R 3/20, BFH/NV 22, 252).
Beachten Sie | Vorsicht ist dagegen angebracht, wenn die Parteien eines Übertragungsvertrags von einer vereinbarten Wertsicherungsklausel keinen Gebrauch machen. Dies lässt zwar für sich allein noch keinen zwingenden Schluss auf ein Fehlen des Rechtsbindungswillens zu. Die Abweichung vom Vereinbarten kann aber im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung von Bedeutung sein (BFH 3.3.04, X R 14/01, BStBl II 04, 826).
Aktuell hat sich das FG Niedersachsen ausführlich mit der Frage beschäftigt, was im Hinblick auf die (weitere) steuerliche Anerkennung eines Versorgungsvertrags als noch unschädlich angesehen werden kann (FG Niedersachsen 27.11.24, 9 K 10007/22). Danach wird die steuerliche Anerkennung eines Versorgungsvertrages in folgenden Fällen nicht gefährdet:
- Bereits vor Vertragsschluss werden Zahlungen in gleicher Höhe und Regelmäßigkeit geleistet, sofern keine Anhaltspunkte für eine andere Rechtsgrundlage als eine Schenkung für die früheren (vorvertraglichen) Zahlungen ersichtlich sind und die fortgesetzten Zahlungen durch den Versorgungsvertrag lediglich auf eine formelle schuldrechtliche Grundlage gestellt worden sind.
- Der Zahlungsumweg des Baraltenteils erfolgt über das Konto der Ehegattin des Zahlungsverpflichteten, denn dies stellt jedenfalls dann eine bloße Modalität der Zahlungsabwicklung dar, wenn der Zahlungsverpflichtete seiner Ehegattin den Betrag noch vor Fälligkeit des Baraltenteils erstattet.Bloße Modalität der Zahlungsabwicklung
- Bei Fehlen entgegenstehender Anhaltspunkte stellt die bloße Unterlassung der versorgungsvertraglich geschuldeten Erhöhung des monatlichen Baraltenteils keine den Rechtsbindungswillen aufhebende Zäsur im Sinne eines „Sich-nicht-mehr-an-die-vertraglichen-Abreden-Gebundenfühlens“ dar, sondern ist im Gegenteil eher als bloße Fortführung des ursprünglichen Rechtsbindungswillens zu sehen, bei der lediglich die Durchführung versehentlich nicht zum vertraglich geschuldeten Zeitpunkt aktualisiert wurde.
- Im Falle einer dauerhaften Überzahlung des monatlichen Baraltenteils ist es jedenfalls für die steuerliche Anerkennung des versorgungsvertraglich geschuldeten Teils des Baraltenteils unschädlich, wenn neben die versorgungsvertraglich veranlasste Zahlung auch eine privat (durch das Verwandtschaftsverhältnis) veranlasste Zahlung tritt, da diese dem versorgungsvertraglich geschuldeten Teil nicht seine obligatorische Natur nimmt und damit ein (insoweit) vorher bestehender Rechtsbindungswillen nicht durch die privat veranlasste Zusatzleistung ausgelöscht wird.Privat veranlasste Zusatzleistung lässt Rechtsbindungswillen nicht entfallen
3. Nachträglich getroffene Vereinbarungen
Die Höhe der Versorgungsleistungen muss grundsätzlich bereits im Vermögensübergabevertrag verbindlich geregelt werden. Der BFH hat zu einer die Höhe der Versorgungsleistungen konkretisierenden nachträglichen vertraglichen Vereinbarung zwischen den Erben oder sonstigen Begünstigten auf der Basis der HöfeO Rheinland-Pfalz entschieden, dass sie den Vorgaben des § 23 Abs. 3 HöfeO Rheinland-Pfalz entsprechen muss, wenn die Leistungen als Sonderausgaben abziehbar sein sollen. Falls die Parteien jedoch Leistungen in einer Höhe vereinbaren wollen, die nicht aus § 23 HöfeO Rheinland-Pfalz abgeleitet werden könnte, müssen sie dies bereits im Übergabevertrag oder in der letztwilligen Verfügung regeln, wenn sie die einkommensteuerrechtliche Anerkennung erreichen wollen (BFH 16.6.21, X R 4/20, BFH/NV 22, 497).
4. Rechtsfolgen, wenn die Ertragsmöglichkeiten aus dem übergebenen Vermögen die Leistungen nicht mehr decken
Einigen sich die Vertragsbeteiligten in Anbetracht des gestiegenen Versorgungsbedürfnisses auf ein neues Versorgungskonzept (z. B. wegen des Umzugs des Versorgungsberechtigten in ein Pflegeheim), sind Zahlungen, die ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Ertrag des übergebenen Vermögens erbracht werden können, freiwillige, nicht abziehbare Leistungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG (BFH 13.12.05, X R 61/01, BStBl II 08, 16). Entsprechendes gilt, soweit die Zahlungen zwar aus dem Ertrag des übergebenen Vermögens erbracht werden können, aber die Anpassung der wiederkehrenden Leistungen zwecks Übernahme eines Pflegerisikos im ursprünglichen Übertragungsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen war.
Beachten Sie | Und werden die Versorgungsleistungen im Fall einer erheblichen Ertragsminderung infolge einer Betriebsverpachtung nicht angepasst, obwohl die Abänderbarkeit aufgrund wesentlich veränderter Bedingungen vertraglich nicht ausgeschlossen war, sind die die dauerhaften Erträge übersteigenden Zahlungen ebenfalls freiwillige Leistungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG (BMF 11.3.10, BStBl I 10, 227, Rn. 62).
5. Schädliche Leistungsaussetzungen
Der weitere Sonderausgabenabzug ist zu versagen, wenn Versorgungsleistungen über einen längeren Zeitraum – im Streitfall insgesamt 17 Monate – vollkommen ausgesetzt werden. Denn dies gefährdet die Versorgung desjenigen, der dem Übernehmer das Vermögen wirtschaftlich betrachtet jedenfalls teilweise unentgeltlich übertragen hat. Nach einer solchen Phase der schwerwiegenden Abweichung vom Üblichen ist ein weiterer Sonderausgabenabzug auch dann ausgeschlossen, wenn der Übernehmer in späteren Jahren die vereinbarten Versorgungsleistungen wieder vertragsgemäß erbringt (BFH 15.9.10, X R 13/09, BStBl II 11, 641).
Entsprechendes gilt, wenn der Vermögensübernehmer über Jahre hinweg nicht die vereinbarten monatlichen Barleistungen von 350 DM erbringt. Im Urteilsfall schlossen die Parteien 16 Jahre nach der Vermögensübertragung, nachdem zuvor die vereinbarten Barleistungen jahrelang nicht erbracht worden waren, eine Änderungsvereinbarung. Aufgrund veränderter Verhältnisse erhöhten sie den monatlichen Barbetrag auf 1.000 DM, der dann nachfolgend auch wie vereinbart gezahlt wurde. Auch hier fehlte den Parteien aufgrund mangelnder Vertragsdurchführung der Rechtsbindungswille mit der Folge, dass auch durch den Abschluss des Änderungsvertrags keine Rückkehr zum vertragsgetreuen Verhalten mehr möglich war (BFH 15.10.10, X R 16/09, BFH/NV 11, 428).
Werden die auf der Grundlage eines Übertragungsvertrags geschuldeten Versorgungsleistungen ohne Änderung der Verhältnisse, also willkürlich nicht mehr erbracht, sind sie steuerrechtlich nicht anzuerkennen, auch wenn die vereinbarten Zahlungen später wieder aufgenommen werden. Entsprechend hat das FG Münster entschieden, dass der erforderliche Rechtsbindungswille fehlt, wenn der Übernehmer die vereinbarten Baraltenteilsleistungen zuerst im Einvernehmen, aber später auch trotz Forderung des Übergebenden nicht zahlt. Erfolgt die Rückkehr zu einem vertragsgemäßen Verhalten durch rechtskräftige Verurteilung eines Zivilgerichts zur Zahlung des Baraltenteils, führt dies nicht zur Anerkennung des Versorgungsvertrags in den Folgejahren (FG Münster 7.12.22, 6 K 2026/20 E, EFG 24, 949; Rev. BFH X R 6/24).
Vergessene Leistungen noch entschuldbar, aber willkürliches Herabsetzen nicht Fazit | Der steuermindernde Abzug von Versorgungsleistungen nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG erfordert nicht nur den Abschluss eines entsprechenden Vermögensübergabevertrags, sondern nachfolgend auch die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen. Während Abweichungen im Sinne eines Vergessens oder Versehens noch unschädlich sein können, führt eine willkürliche Herabsetzung oder gar Nichtzahlung der vereinbarten Versorgungsleistungen zur Versagung der steuerlichen Anerkennung für die Zukunft. Dies gilt auch dann, wenn nachfolgend wieder zur Zahlung der vereinbarten Beträge zurückgekehrt wird. Die Änderung von Versorgungsleistungen der Höhe nach aufgrund einer Veränderung des Versorgungsbedürfnisses des Empfängers oder einer veränderten Ertragssituation des Zahlungsverpflichteten bedürfen zur steuerlichen Anerkennung einer entsprechenden vertraglichen Grundlage. |
AUSGABE: GStB 7/2025, S. 247 · ID: 50417896