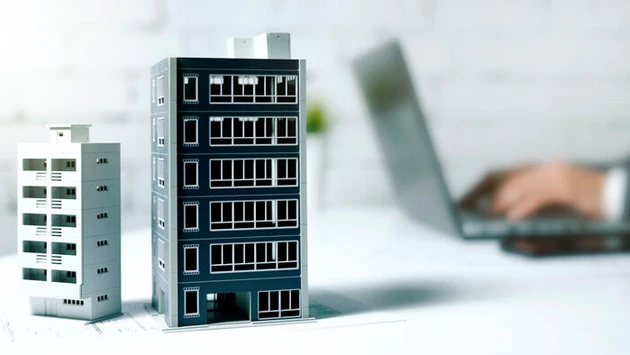Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.
SteuertickerNeues aus der Gesetzgebung, Finanzverwaltung und Rechtsprechung auf den Punkt gebracht
| Im „Steuerticker“ weisen wir regelmäßig auf Neuerungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Finanzverwaltung hin, die Sie im Berufsalltag kurzfristig umsetzen sollten. In diesem Beitrag geht es u. a. um neue Details zum Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer bei Gebäuden, um die Zulässigkeit der rückwirkenden Besteuerung von „Alt-Lebensversicherungsverträgen“ und um Gefahren bei Grundstücksübertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge. |
Inhaltsverzeichnis
- 1. Nachweis der kürzeren Gebäudenutzungsdauer: Verwaltungsauffassung verworfen
- 2. Alt-Lebensversicherungsverträge und Verrentung: Rückwirkende Besteuerung des Ertragsanteils rechtens?
- 3. Ablösung eines Nießbrauchs: Wem fließen Kapitaleinkünfte zu?
- 4. Gefahren bei Grundstücksübertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge
1. Nachweis der kürzeren Gebäudenutzungsdauer: Verwaltungsauffassung verworfen
Sofern die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes niedriger ist als die gesetzlich typisierte Nutzungsdauer, kann die Abschreibung auf Grundlage der tatsächlichen Nutzungsdauer erfolgen. Offen ist gegenwärtig insbesondere die Frage, wie der Nachweis der tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer gegenüber der Finanzverwaltung zu erbringen ist. Entgegen der Auffassung des Fiskus (BMF 22.2.23, BStBl I 23, 332, Rz. 24) lässt der BFH jede sachverständige Methode zum Nachweis der zu schätzenden Nutzungsdauer zu (BFH 23.1.24, IX R 14/23, BFH/NV 24, 823). Die Finanzverwaltung lehnt gegenwärtig die bloße Übernahme einer Restnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten ab.
Dem folgt das FG Münster (2.4.25, 14 K 654/23 E, Rev. nicht zugelassen) unter Hinweis auf die o. g. BFH-Rechtsprechung jedoch nicht; die Ablehnung von Verkehrswertgutachten als Basis für eine Schätzung der Nutzungsdauer sei nicht tragfähig, weil hierfür kein gesetzlicher Ausschluss bestehe. Das Gutachten sei aber nur dann geeignet, wenn der Sachverständige das Objekt selbst vor Ort in Augenschein genommen habe.
Im Streitfall des FG Münster lehnte die Finanzverwaltung die ermittelte Restnutzungsdauer auch deshalb ab, weil der das Gutachten ausstellende Sachverständige keine Zertifizierung als Sachverständiger für Immobilienbewertung nach DIN EN ISO/IEC 17024 nachweisen konnte. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung wird vom FG Münster (a. a. O.) eine solche Zertifizierung aber nicht verlangt, weil der Gesetzgeber in § 7 Abs. 4 S. 2 EStG keine derartige formelle Anforderung formuliert hat.
Beachten Sie | Der Gutachter muss aber selbstverständlich für diese Tätigkeit qualifiziert sein. Um weitere Diskussionen mit der Finanzverwaltung zu verhindern, sollte in der Praxis weiterhin ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 beauftragt werden. Die Entscheidung des FG Münster dürfte aber ausreichen, um eine AdV hinsichtlich der strittigen Steuer aufgrund eines vom Fiskus nicht akzeptierten Verkehrswertgutachtens zu erreichen. Eine bundeseinheitliche Verwaltungsanweisung bleibt abzuwarten – sie ist aber dringend erforderlich.
2. Alt-Lebensversicherungsverträge und Verrentung: Rückwirkende Besteuerung des Ertragsanteils rechtens?
Der BFH hat sich mit der Frage der Versteuerung von verrenteten begünstigten Alt-Lebensversicherungsverträgen (Abschluss vor dem 1.1.05) bereits im Jahr 2021 auseinandergesetzt. Er hatte seinerzeit Folgendes entschieden (1.7.21, VIII R 4/18):
- Die in den Rentenzahlungen enthaltenen Zinsen sind den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen und bei Anwendung des sog. Lebensversicherungsprivilegs steuerfrei (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 S. 2 EStG 2004).
- Die Auszahlung des angesammelten Kapitalguthabens einschließlich Überschussanteile löst ferner keine Ertragsteuerpflicht aus, solange die Auszahlung diesen Betrag nicht überschreitet.
Beachten Sie | Der BFH hat sich gegen eine von der Finanzverwaltung vorgenommene Besteuerung der Rentenzahlung als sonstige Einkünfte mit dem Ertragsanteil ausgesprochen. Lange Zeit hat die Finanzverwaltung auf diese unliebsame Rechtsprechung nicht reagiert. Erst durch das JStG 2024 hat der Gesetzgeber eine rechtsprechungsbrechende Gesetzesänderung – und zwar rückwirkend für alle noch offenen Fälle – verabschiedet. In § 52 Abs. 28 S. 5 EStG wird die vom BFH verworfene Verwaltungsauffassung gesetzlich festgeschrieben.
Der Gesetzgeber begründet die Rechtsänderung mit einer gesetzlichen Klarstellung. Ob diese Rechtsänderung überhaupt zu dem vom Gesetzgeber und der Finanzverwaltung gewünschten Besteuerungsziel führt, bleibt gegenwärtig abzuwarten.
- Strittig ist zunächst, ob der Gesetzgeber in 2024 rückwirkend für die Vorjahre die durch die BFH-Rechtsprechung geklärte Rechtsauslegung durch eine rechtsprechungsbrechende Gesetzesänderung zugunsten der Ertragsbesteuerung verfassungsgemäß ändern durfte. Hieran bestehen erhebliche Zweifel.Neuregelung verfassungsmäßig höchst bedenklich
- Strittig ist zudem, ob die Gesetzesänderung ab dem VZ 2024 zu dem gewünschten Besteuerungsziel führt oder ob dem Gesetzgeber eine Umqualifizierung der Einkunftsart untersagt ist.
Beachten Sie | Zu diesen Fragen ist vor dem FG Nürnberg ein Musterverfahren unter dem Az. 6 K 1408/24 anhängig. In der Praxis sollten diesbezügliche Einsprüche in früheren Veranlagungsjahren, deren Bearbeitung von den Rechtsbehelfsstellen der Finanzverwaltung nun wieder aufgenommen wird, nicht zurückgenommen werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung im Hinblick auf das anhängige Musterverfahren vergleichbare Sachverhalte aus Zweckmäßigkeitsgründen weiterhin ruhend stellen wird (§ 363 Abs. 2 S. 1 AO).
3. Ablösung eines Nießbrauchs: Wem fließen Kapitaleinkünfte zu?
Der BFH hat sich mit Urteil vom 11.2.25 (IX R 14/24) erneut zur entgeltlichen Ablösung eines unentgeltlich eingeräumten Nießbrauchrechts an einer GmbH-Beteiligung geäußert. Danach löst die Ablösung des unentgeltlich eingeräumten Nießbrauchrechts für den Ablösungsempfänger keinen steuerbaren Vorgang aus, sofern diesem kein wirtschaftliches Eigentum an dem nießbrauchbelasteten Geschäftsanteil zusteht (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO). Der BFH bestätigt damit seine frühere Rechtsauffassung (BFH 20.9.24, IX R 5/24, BFH/NV 25, 71).
Beachten Sie | Beim Nießbrauchberechtigten ist nur dann von wirtschaftlichem Eigentum an dem belasteten Geschäftsanteil auszugehen, wenn er entscheidenden Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft nehmen kann. Das wirtschaftliche Eigentum lag in den vorgenannten Fällen nicht beim Nießbrauchberechtigten, weil das Nießbrauchrecht nicht die Ausübung von für die Gesellschaft wesentlichen Stimmrechten umfasste. Somit hatte er die Ausschüttungen auch nicht zu versteuern. § 20 Abs. 5 S. 3 EStG bestimmt Folgendes:
§ 20 Abs. 5 S. 3 EStG |
3Sind einem Nießbraucher … die Einnahmen i. S. d. (§ 20) Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 (EStG) zuzurechnen, gilt er als Anteilseigner. |
Ohne wirtschaftliches Eigentum wird dem Nießbraucher die Ausschüttungseinnahme nicht zugerechnet. Die Ausschüttung ist den Anteilseignern zuzurechnen; die Weiterleitung der Nettoausschüttung an den Nießbraucher ist als bloße Einkommensverwendung anzusehen (Bodden, BeSt 2/2025, 13 ff).
Beachten Sie | Mit Schreiben vom 14.5.25 (IV C 1 - S 2252/00075/016/070) hat sich die Finanzverwaltung zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer geäußert. In Rz. 117a dieses Schreibens wurden – fast unbemerkt – Ausführungen zur Zurechnung von Einkünften bei Nießbrauch aufgenommen. Der Rechtsprechung folgend werden die Einkünfte i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG (vornehmlich offene Gewinnausschüttungen) dem wirtschaftlichen Eigentümer zugerechnet. Es gelten hierbei die Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO. Eine vorbehaltlose Zurechnung der Einkünfte im Fall des Vorbehaltsnießbrauchs beim Nießbraucher, wie es das aufgehobene BMF-Schreiben vom 23.11.83 (BStBl I 1983, 508) in Rn. 55 noch vorsah, scheidet damit aus.
4. Gefahren bei Grundstücksübertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge
Gerade bei Vereinbarungen im Familienverbund werden oftmals Regelungen getroffen, die steuerliche Folgewirkungen außer Acht lassen. Zu beobachten ist dies insbesondere bei Grundstücksübertragungen, in denen unerwartet § 23 EStG ins Spiel kommt. In einem aktuellen Streitfall vor dem BFH wurde eine Immobilie in 2014 für rd. 144.000 EUR erworben, bis 2019 vermietet und dann gegen Übernahme der Restdarlehensschuld von rd. 115.000 EUR von der Tochter des vormaligen Eigentümers übernommen. Im Zeitpunkt der Übertragung hatte das Objekt einen Verkehrswert von 210.000 EUR. Die Finanzverwaltung ging von einem teilentgeltlichen Vorgang aus. Für den entgeltlichen Teil wurde ein privates Veräußerungsgeschäft angenommen.
Ermittlung des entgeltlichen Teils | |
Verkehrswert des Gebäudes bei Übertragung | 210.000 EUR (100,00 %) |
Schuldübernahme (= entgeltlicher Teil) | 115.000 EUR (54,76 %) |
Unentgeltlicher Teil | 95.000 EUR (45,24 %) |
Bei Ermittlung des Veräußerungsgewinns hat die Finanzverwaltung von dem entgeltlichen Teil i. H. v. 115.000 EUR die anteiligen Anschaffungskosten – unter Erhöhung um die anteilige Gebäude-Abschreibung – und die anteiligen Veräußerungskosten in Höhe der Entgeltlichkeitsquote (54,76 %) abgezogen. Das FG Niedersachsen verneinte hingegen ein privates Veräußerungsgeschäft, weil bei einer entgeltlichen Übertragung unterhalb der ursprünglichen Anschaffungskosten nicht von einem „Geschäft“ zu sprechen sei (FG Niedersachsen 29.5.24, 3 K 36/24).
Der BFH schloss sich der Auffassung des FG nicht an und bestätigte die Verwaltungsauffassung (BFH 11.3.25, IX R 17/24). § 23 EStG kommt danach nicht nur bei vollentgeltlichen Rechtsgeschäften zur Anwendung, sondern auch bei teilentgeltlichen Übertragungen, selbst wenn der entgeltliche Teil unter den ursprünglichen Anschaffungskosten liegt. Der entgeltliche Teil lag im Entscheidungsfall in der Schuldübernahme (Rz. 16). Die Veräußerungskosten und die um die Abschreibung bereinigten Anschaffungskosten sind in Höhe der Entgeltlichkeitsquote bei Ermittlung des Veräußerungsgewinns zu berücksichtigen. Für die übernehmende Tochter löst dies folgende Rechtsfolgen aus:
- In Bezug auf den entgeltlichen Teil der Grundstücksübertragung liegen Anschaffungskosten vor. Die Anschaffungskosten sind in einen Anteil für den Grund und Boden und den Gebäudeanteil (abschreibungsfähig) aufzuteilen. In Bezug auf den entgeltlichen Teil können anschaffungsnahe Herstellungskosten begründet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Für die Grundstücksübernehmerin beginnt insoweit eine eigene neue Zehnjahresfrist (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG).
- In Bezug auf den unentgeltlichen Teil der Grundstücksübertragung gilt die Fußstapfen-Theorie. D. h. insoweit wird die Abschreibungs-BMG des Rechtsvorgängers fortgeführt und die Grundstücksübernehmerin tritt in die noch laufende Zehnjahresfrist des § 23 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG ein.Für unentgeltlichen Teil der Übertragung gilt die Fußstapfen-Theorie
In einer weiteren praxisbedeutsamen Entscheidung hatte sich der BFH mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sich eine Übertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ohne Schuldübertragung auswirkt.
In dem zu entscheidenden Sachverhalt übertrug der Vater als Objektalleineigentümer 2/5 eines Vermietungsobjekts unentgeltlich auf seinen Sohn. Der Sohn übernahm die Darlehensverbindlichkeiten aus dem Objekterwerb nicht (auch nicht anteilig). Nach Auffassung des BFH liegt zwar eine unentgeltliche Übertragung auf den Sohn vor. Der übertragende Vater kann nach der Objektübertragung aber nur noch 3/5 der ihm entstehenden Schuldzinsen als (Sonder-)Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machen. Im Entscheidungsfall waren von den tatsächlich angefallenen Schuldzinsen von rd. 60.000 EUR nur noch rd. 36.000 EUR steuerwirksam.
AUSGABE: GStB 7/2025, S. 238 · ID: 50446970