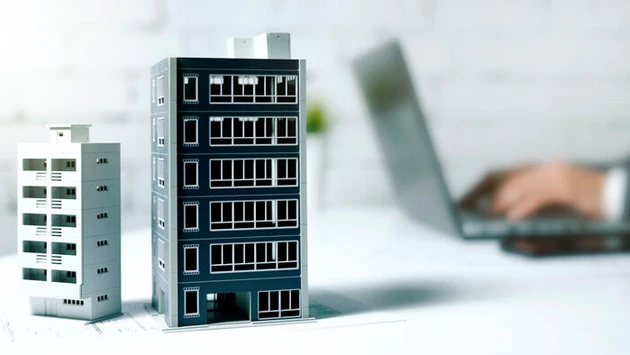Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.
Der praktische FallKeine Sonderabschreibung nach § 7b Abs. 1 EStG für Ersatzneubauten
| Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus (BGBl I 19, 1122) wollte der Gesetzgeber mit der neuen Sonderabschreibung nach § 7b EStG steuerliche Anreize für Investitionen im bezahlbaren Mietsegment schaffen. In seinem Urteil vom 12.9.24 (1 K 2206/21, Rev. BFH IX R 24/24) hat sich das FG Köln mit der Frage beschäftigt, ob der Abriss eines vermieteten Einfamilienhauses mit anschließendem Neubau eines Einfamilienhauses in den Anwendungsbereich des § 7b EStG fällt. Der folgende Musterfall stellt die jüngste Rechtsentwicklung dar. |
Sachverhalt
Die Eheleute A und B werden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt und erzielen u. a. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Auf einem der vermieteten Grundstücke stand bis zum Juni 2020 ein 1962 errichtetes Einfamilienhaus. Nachdem der Landkreis die Eheleute 2018 zur Sanierung der Abwasserrohre aufgefordert hatte, ließen diese eine Baukostenschätzung zur Renovierung des gesamten Hauses vornehmen. Die Baufirma kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Gebäudes auf einen „zukunftsfähigen Standard“ Investitionen von ca. 106.000 EUR bedeuten würde. Ende 2018 entschlossen sich die Eheleute, das bestehende Gebäude abzureißen. Im Februar 2019 entschieden sie sich für den Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück. Dieser erfolgte im Zeitraum Juli bis Dezember 2020 durch eine Fertighausfirma. Die Herstellungskosten beliefen sich auf rd. 305.000 EUR.
Im Rahmen der ESt-Erklärung für 2020 machten die Eheleute im Bereich Vermietung und Verpachtung eine Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b EStG i. H. v. 15.209,43 EUR geltend. Mit Bescheid aus Juni 2021 versagte das FA die Gewährung der Sonderabschreibung. Nach Auffassung des FA erfülle der Neubau nicht die Voraussetzungen, die das Gesetz an die Gewährung der Sonderabschreibung knüpft, da es sich nicht um neuen, bisher nicht vorhandenen Wohnraum i. S. dieser Vorschrift handele. Hiergegen richtet sich die Klage der Eheleute, jedoch ohne Erfolg.
Entscheidungsgründe
Nach Ansicht des FG Köln hat das FA die Einkommensteuer 2020 zu Recht ohne Berücksichtigung der Sonderabschreibung i. H. v. 15.209,45 EUR festgesetzt. Als Begründung führt es an, dass der Anwendungsbereich der Sonderabschreibung nicht eröffnet war.
Nach § 7b Abs. 1 EStG können für die Anschaffung oder Herstellung neuer Wohnungen, die in einem Mitgliedstaat der EU belegen sind, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren Sonderabschreibungen von bis zu jährlich 5 % der Bemessungsgrundlage neben der AfA nach § 7 Abs. 4 oder 5a EStG in Anspruch genommen werden.
Voraussetzung dafür ist nach § 7b Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG, dass durch Baumaßnahmen aufgrund eines nach dem 31.8.18 und vor dem 1.1.22 gestellten Bauantrags neue, bisher nicht vorhandene Wohnungen hergestellt werden, die die Voraussetzungen des § 181 Abs. 9 BewG erfüllen. Weitere Voraussetzung ist, dass die neue Wohnung für insgesamt zehn Jahre vermietet und die Baukostenobergrenze vom 3.000 EUR/qm nicht überschritten wird.
Diese Voraussetzungen waren für das Gericht vorliegend nicht erfüllt. Das neu errichtete Einfamilienhaus stellt nach der Überzeugung des Senats keine neue, noch nicht vorhandene Wohnung i. S. d. Gesetzes dar. Zwar haben die Eheleute auf Grundlage eines Bauantrags im benannten Zeitraum ein Einfamilienhaus errichten lassen, das nunmehr vermietet wird. Auch die Baukostenobergrenze wurde nicht überschritten. Die Voraussetzungen des § 7b Abs. 2 EStG müssen aber kumulativ vorliegen, sodass die Sonderabschreibung insgesamt nicht in Anspruch genommen werden kann.
Lenkungszweck verlangt vorher nicht vorhandene Wohnung |
Die Regelung ist Teil der von der damaligen Bundesregierung initiierten sog. Wohnraum-Offensive. Ziel der Regelung war die Schaffung neuer Wohnungen durch eine gezielte steuerliche Förderung von Neubauten und Umbaumaßnahmen in bestehenden Gebäuden. Hierdurch sollte dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen entgegengewirkt werden (vgl. BT-Drs. 19/4949, 1). Soweit das Gesetz die Schaffung einer „nicht vorhandenen Wohnung“ fordert, sei damit nach der Lesart des FG Köln nicht auf eine zeitliche, sondern auf eine quantitative Auslegung abzustellen.
Diese Lesart wird auch von der Begründung des Gesetzesentwurfs (vgl. BT-Drs. 19/4949, 12) gestützt: „Entsprechend dem Ziel des Gesetzes kommt es darauf an, dass neue Wohnungen geschaffen werden. Die Wohnung muss zusätzlich und erstmalig und damit neu geschaffen werden. Baumaßnahmen, die zu einer Verlegung von Wohnraum oder Erweiterung der Wohnfläche innerhalb eines Gebäudes führen, erfüllen die Fördervoraussetzungen nicht.“
Beachten Sie | Insofern kann laut Gericht auch nicht darauf abgestellt werden, dass für einen gewissen Zeitraum kein Haus auf dem Grundstück gestanden hat und wie lange dieser Zustand angedauert hat. Maßgeblich sei vielmehr, dass die Baumaßnahme im Ergebnis nicht zu einer zusätzlichen Wohnung führte, sondern lediglich eine alte Wohnung durch eine neue ersetzt wurde. Die Ersetzung führt nicht zu einer weiteren zählbaren Wohneinheit und entspricht nicht dem dargestellten Förderungszweck des § 7b Abs. 2 EStG, denn eine Ersetzung wirkt nicht gleichsam gegen die vom Gesetzgeber anvisierte Wohnungsknappheit.
Demnach führt auch der von den Eheleuten angeführte bessere Ausbau- und Energiestandard des Neubaus nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Zwar war es ausweislich der durch das JStG 2022 vom 16.12.22 unter § 7b Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG aufgenommenen zusätzlichen energetischen Voraussetzungen auch ein gesetzgeberisches Ziel, energieeffizientes Bauen zu fördern. Danach kann die Sonderabschreibung für Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31.12.22 und vor dem 1.1.27 gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden, nämlich nur in Anspruch genommen werden, wenn diese in einem Gebäude liegen, das die Kriterien „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsklasse erfüllt und dies durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude nachgewiesen wird.
Die vorliegend zu beurteilende Baumaßnahme unterliegt aber bereits in zeitlicher Hinsicht nicht diesem zusätzlichen Kriterium. Unabhängig davon stehe der inzwischen auch energetisch motivierte Förderungszweck des § 7b EStG der vorgenommenen Auslegung nicht entgegen. Denn die ursprüngliche gesetzgeberische Zielsetzung sei hierdurch nicht aufgegeben worden. Durch die Aufnahme der energetischen Voraussetzungen wird das Leitmotiv der Begünstigung – nämlich die Bekämpfung der Wohnungsnot (vgl. BT-Drs. 19/4949, 1) – nicht verdrängt, sondern lediglich ergänzt.
Das gefundene Ergebnis werde dadurch bekräftigt, dass Sanierungen (unstreitig) nicht vom Förderungszweck gedeckt sind. Sanierungen dienen naturgemäß der Anhebung des bestehenden Wohnstandards in bautechnischer wie energetischer Weise. Nach einhelliger Ansicht entsteht aber gerade keine neue Wohnung i. S. d. Vorschrift, wenn vorhandener Wohnraum nur modernisiert oder saniert wird (vgl. BMF 7.7.20, IV C 3 - S 2197/19/10009 :008, BStBl I 20, 623, Rn. 26). Das bedeutet umgekehrt auch, die mit der Sanierung einhergehende Standardverbesserung und Verlängerung der wohnlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes unterfallen nicht dem Begünstigungszweck der Norm. Auf dieser Grundlage war der Vortrag der Eheleute, der Neubau habe zu einer deutlichen Verbesserung des wohnlichen Standards geführt und die Wohnung sei deutlich länger als solche nutzbar, als das in die Jahre gekommene EFH, unerheblich.
Information Revision unter dem Az. IX R 24/24 anhängig |
Zum Autor | Gerrit Uphues ist in der Finanzverwaltung NRW tätig. Der Aufsatz wurde nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst und gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder.
AUSGABE: GStB 7/2025, S. 251 · ID: 50429511