
Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Aug. 2025 abgeschlossen.
ScheidungDas Ehegattenerbrecht und familienrechtliche Konsequenzen im Scheidungsverfahren
| Die Scheidungsquote in Deutschland lag zuletzt bei rund 37 Prozent. In diesem Kontext spielt aus juristischer Sicht das Zusammenspiel von Erb- und Familienrecht eine wichtige Rolle. Ab wann und unter welchen Voraussetzungen entfällt im Falle einer Trennung das Ehegattenerbrecht? Welche Konsequenzen hat der Tod eines Ehepartners im Scheidungsverfahren? Und welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für Zugewinnausgleichsansprüche? Diese und weitere Fragen beantwortet dieser Beitrag. |
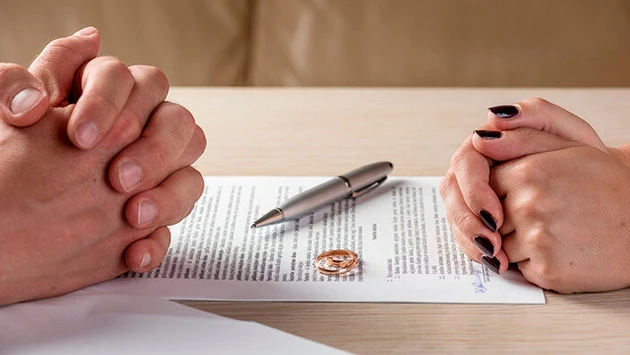
1. Das gesetzliche Erbrecht von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner gehören bekanntlich zu den gesetzlichen Erben (§ 1931 BGB, § 210 LPartG). Dabei richtet sich die Erbquote zum einen danach, neben welchen Verwandten geerbt wird, und zum anderen, in welchem Güterstand die Eheleute verheiratet waren.
a) Erbrechtliche Sicht der Quote
Neben Abkömmlingen des Erblassers (Verwandte erster Ordnung), egal ob ehelich oder nicht ehelich, sind der überlebende Ehegatte und der eingetragene Lebenspartner Erbe zu einem Viertel (§ 1931 Abs. 1 S. 1 BGB, § 10 Abs. 1 S. 1 LPartG). Auf die Anzahl der Abkömmlinge kommt es hierbei nicht an.
Neben Erben der zweiten Ordnung erhält der Ehegatte die Hälfte.
Neben Großeltern sind Ehegatte und Lebenspartner ebenfalls Erbe zu ein Halb (§ 1931 Abs. 1 S. 1 BGB, § 10 Abs. 1 S. 1 LPartG). Leben nicht mehr alle Großelternteile, so geht der Anteil, der an sich nach § 1926 Abs. 3 S. 1 BGB auf die Abkömmlinge der verstorbenen Großeltern übergehen würde, auf den Ehegatten/Lebenspartner über (§ 1931 Abs. 1 S. 2 BGB, § 10 Abs. 1 S. 2 LPartG). Sind ein oder mehrere Großelternteile vorverstorben, ohne Abkömmlinge zu hinterlassen, fallen die entsprechenden Anteile nicht dem Ehegatten/Lebenspartner, sondern dem anderen Teil des Großelternehepaars oder dem anderen Großelternpaar zu (§ 1926 Abs. 3 S. 2 u. Abs. 4 BGB).
Ist der Ehegatte/Lebenspartner zugleich als Verwandter erbberechtigt, erhält er im Ergebnis zwei Erbteile, nämlich denjenigen, der ihm als Ehegatte/Lebenspartner zusteht, und denjenigen, der ihm als Verwandter zusteht (§ 1934 BGB, § 10 Abs. 1 S. 6 LPartG). Da es sich nach § 1934 S. 2 BGB (bzw. § 10 Abs. 1 S. 7 LPartG) um besondere Erbteile handelt, können sie unabhängig voneinander ausgeschlagen werden.
Führte der Erblasser eine Doppelehe, steht der nach den oben genannten Grundsätzen berechnete Erbteil beiden überlebenden Ehegatten gemeinsam zu, erhöht sich aufgrund dieses besonderen Umstands jedoch nicht (vgl. KG 28.9.76, 1 W 2616/76, OLGZ 77, 386 (387)). Soweit nicht § 1318 Abs. 5 BGB eingreift, sind beide Ehegatten des Erblassers daher zu gesetzlichen Erben berufen. Dies ist im Gesetz nicht ausdrücklich gesagt, kann aber im Wege des Umkehrschlusses aus § 1318 Abs. 5 BGB entnommen werden und entspricht im Übrigen dem Prinzip, dass eine aufhebbare Ehe dieselben Rechtswirkungen hat wie eine fehlerfreie Ehe, solange keine gerichtliche Aufhebung erfolgt ist.
b) Güterrechtliche Einflüsse
Beeinflusst wird die Erbquote des Ehegatten darüber hinaus durch den Güterstand. Hier sieht das Gesetz für die Gütertrennung (§ 1931 Abs. 4 BGB) und die Zugewinngemeinschaft (§ 1931 Abs. 3 i. V. m § 1371 Abs. 1 BGB) Sonderregelungen vor.
Bei Gütertrennung sorgen § 1931 Abs. 4 BGB und § 10 Abs. 2 S. 2 LPartG dafür, dass der überlebende Ehegatte/Lebenspartner neben den zu Erben berufenen Kindern (oder deren Abkömmlingen) an dem Nachlass mindestens gleichermaßen beteiligt ist: bei einem Kind zu ein Halb, bei zwei Kindern zu einem Drittel. Im Übrigen, so auch bei drei oder mehr zu Erben berufenen Kindern, führt die Gütertrennung zu keinen Besonderheiten.
Bei der Gütergemeinschaft und bei der deutsch-französischen Wahlzugewinngemeinschaft ändert sich an der Erbquote nach a) nichts.
2. Voraussetzung gültige Ehe
Das gesetzliche Erbrecht setzt hier das Bestehen einer gültigen Ehe bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaft voraus. Eine analoge Anwendung des § 1931 auf Fälle der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft (d. h. auf eheähnliche Beziehungen von Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts) ist (schon mangels unbeabsichtigter Regelungslücke im Gesetz) nicht möglich (Allg. Meinung, OLG Saarbrücken NJW 79, 2050; OLG Frankfurt NJW 82, 1885; Strätz FamRZ 80, 301 (306); Bosch FamRZ 82, 227 (238); Schlüter, Die nichteheliche Lebensgemeinschaft, 1981, 35; Diederichsen NJW 83, 1017 (1024 f.); Battes, Nichteheliches Zusammenleben im Zivilrecht, 1983, 155; Erman/Lieder Rn. 11; Grüneberg/Weidlich, BGB, 84. Aufl.,§ 1931 Rn. 2; Soergel/Fischinger, BGB, 2021, § 1931 Rn. 19; Staudinger/Werner, BGB, 2017, § 1931 Rn. 7).
Besteht keine gültige Ehe, gibt es auch kein gesetzliches Erbrecht.
War die Ehe im Zeitpunkt des Erbfalls rechtskräftig geschieden (§ 1564 S. 2 BGB) oder aufgehoben (§ 1313 S. 2 BGB), wird der bisherige Ehegatte nicht gesetzlicher Erbe. Seine vermögensrechtlichen Ansprüche aus der Ehe sind dann allein nach Familienrecht zu beurteilen. Bei erfolgreicher Wiederaufnahmeklage gegen rechtskräftige Scheidungs- oder Aufhebungsurteile bzw. -beschlüsse (§ 118 FamFG) werden auch die erbrechtlichen Folgen der Ehe wieder hergestellt. Es dürfte aber zu weit gehen, dies schon dann zu bejahen, wenn zu Lebzeiten beider Ehegatten Wiederaufnahmeklage erhoben wurde (dafür Stein/Jonas/Jacobs, ZPO, 2018, § 578 Rn. 5). Mit dem Tod eines Ehegatten wird die Wiederaufnahmeklage unzulässig.
3. Vorverlagerung nach § 1933 BGB
Das gesetzliche Ehegattenerbrecht entfällt, obwohl die Ehe/Lebenspartnerschaft noch besteht, wenn
- zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe vorlagen und der Erblasser entweder die Scheidung beantragt oder dem Scheidungsantrag des Ehegatten zugestimmt hatte (§ 1933 S. 1 BGB),
- der Erblasser berechtigt war, die Aufhebung der Ehe nach den §§ 1313 ff. BGB zu beantragen und den Antrag gestellt hatte (§ 1933 S. 2 BGB),
- zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Aufhebung der Lebenspartnerschaft vorlagen und der Erblasser entweder die Aufhebung beantragt oder ihr zugestimmt hat (§ 10 Abs. 3 LPartG).
a) Formelle Voraussetzungen
Der überlebende Ehegatte verliert sein gesetzliches Erbrecht (§ 1931 BGB), den Anspruch auf den Voraus (§ 1932 BGB) und auch seinen Anspruch auf den Pflichtteil, wenn der Erblasser den Scheidungsantrag vor seinem Tod gestellt oder er dem Scheidungsantrag des anderen Ehegatten zugestimmt hat (§ 1933 S. 1 BGB) oder er einen Antrag auf Aufhebung der Ehe gestellt hat (§ 1933 S. 2 BGB).
aa) Eigener Antrag des Erblassers
Die Stellung des Scheidungs- oder Aufhebungsantrags (§§ 124, 133, 134 FamFG) entfaltet ihre das Erbrecht ausschließende Wirkung erst mit Rechtshängigkeit, also mit Zustellung des Schriftsatzes (§ 113 Abs. 1 FamFG, § 261 Abs. 1, § 253 ZPO; BGH 6.6.90, IV ZR 88/89, NJW 90, 2382; MüKo/Leipold, BGB, § 1933 Rn. 5 m. w. N.). Die bloße Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens vor dem Tod des Erblassers genügt nicht. Eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Einreichung (§ 167 ZPO) scheidet aus, weil es weder um eine Fristwahrung zur Erhaltung eines Rechts noch um die Unterbrechung oder Hemmung einer Verjährung geht (BGH 6.6.90, IV ZR 88/89, NJW 90, 2382). Es reicht nicht aus, einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe zu stellen.
praxistipp | In diesem Zusammenhang ist auf folgende Haftungsfalle zu achten: Nur bei einem wirksamen Scheidungsantrag ist das Ehegattenerbrecht ausgeschlossen. Zu seiner Stellung bedarf der Anwalt einer besonderen, auf das Verfahren gerichteten Vollmacht. Eine Generalvollmacht oder eine allgemeine Prozessvollmacht genügen nicht (OLG Brandenburg 9.8.22, 3 W 17/22). Im Scheidungsverfahren bedarf der Bevollmächtigte einer besonderen, auf das Verfahren gerichteten Vollmacht (§ 114 V FamFG). Die Vollmacht in Ehesachen muss neben den Parteien auch die Ehesache genau bezeichnen, auf die sie sich bezieht.
Beachten Sie | Ein kurzer Exkurs zum Nichtbetreiben des Verfahrens: Das Nichtbetreiben des Scheidungsverfahrens beseitigt zwar die Rechtshängigkeit nicht (BGH NJW-RR 93, 898; OLG Köln FamRZ 12, 1755), allerdings sei ein Stillstand über einen langen Zeitraum einer Antragsrücknahme gleichzustellen (OLG Düsseldorf FamRZ 91, 1107: 26 Jahre; OLG Saarbrücken MDR 11, 50: 21 Jahre; siehe auch OLG Hamm NJW-RR 21, 587; OLG Düsseldorf FamRZ 18, 139).
bb) Zustimmung zum Antrag des anderen Ehegatten
Die Zustimmung setzt Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens voraus; sie kann in einem Schriftsatz des Prozessbevollmächtigten, aber auch vom Erblasser selbst zu Protokoll der Geschäftsstelle oder in der mündlichen Verhandlung zur Niederschrift des Gerichts (§ 134 Abs. 1 FamFG) erklärt werden. Die Zustimmung braucht nicht ausdrücklich erteilt zu werden; es genügt, wenn sich aus der Erklärung ergibt, dass auch der Erblasser die Ehe für gescheitert hält und einer Scheidung nicht entgegentritt (OLG Köln ZEV 03, 326 m. Anm. Werner). Es genügt auch eine schriftliche Erklärung der anwaltlich nicht vertretenen Partei an das Gericht (OLG Köln NJW 13, 2831; OLG Stuttgart OLGZ 93, 263; Czubayko ZEV 09, 551 (552)). Eine lediglich dem anderen Ehegatten gegenüber erteilte Zustimmung (LG Düsseldorf Rpfleger 80, 187) reicht ebenso wenig aus wie die bloße Unterzeichnung einer Scheidungsfolgenvereinbarung (BGHZ 128, 125 = ZEV 95, 150 m. Anm. Klumpp; OLG Zweibrücken OLGZ 83, 160).
Eine im Prozesskosten- bzw. Verfahrenskostenhilfeverfahren erklärte Zustimmung wird mit der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens wirksam (OLG Zweibrücken NJW 95, 601). Denn ausreichend ist nach dem Wortlaut der Vorschrift gleichermaßen die Zustimmung des Ehegatten zur Scheidung, die indessen erst bei Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages des anderen Ehegatten rechtliche Relevanz entfaltet. Wird daher die Zustimmung des Erblassers bereits vor Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages des anderen Ehegatten erklärt, gilt dessen Zustimmung mit Zustellung des Scheidungsantrages des anderen Ehegatten als erteilt (MüKo/Leipold, BGB, 17. Aufl., § 1933, Rn. 9 m. w. N.).
Ein (gem. § 134 Abs. 2 FamFG). bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung möglicher) Widerruf der Zustimmung lässt die Rechtsfolge des § 1933 entfallen. Ein nicht wirksam gestellter eigener Scheidungsantrag kann in eine Zustimmungserklärung umzudeuten sein (OLG Celle NJW 13, 2912; OLG Zweibrücken NJW 95, 601 (602); jurisPK-BGB/Schmidt, § 1933 Rn. 15).
Beachten Sie | Die Zustimmung des Erblassers zur Scheidung im Sinne von § 1933 S. 1 BGB kann auch unter Geltung des FamFG wirksam durch privatschriftliche Erklärung gegenüber dem Familiengericht erfolgen, § 134 Abs. 1, § 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG. Der Ausschluss des Ehegattenerbrechts nach § 1933 S. 1 BGB hängt nicht davon ab, dass der Scheidungsantrag des überlebenden Ehegatten, dem der Erblasser zugestimmt hatte, die nach § 133 Abs. 1 Nr. 2 FamFG notwendigen Angaben enthielt (OLG Köln 11.3.13, 2 Wx 64/13).
b) Materielle Voraussetzungen
Die Voraussetzungen der Scheidung können nach dem Grundtatbestand des § 1565 oder nach den Vermutungen des § 1566 Abs. 1 und 2 BGB gegeben sein. Das Gericht, das über die Anwendung des § 1933 zu entscheiden hat, muss prüfen, ob der Scheidungsantrag erfolgreich gewesen wäre, wenn das Verfahren nicht wegen des Todes des Erblassers beendet worden wäre. Das Scheitern der Ehe (§ 1565 Abs. 1 BGB) ist nach den subjektiven Vorstellungen der Ehegatten bezüglich ihrer konkreten Lebensgemeinschaft festzustellen (BGHZ 128, 125 = NJW 95, 1082). Insoweit gelten die normalen Beweisanforderungen (für „strenge“ Anforderungen Schmitz in: Baumgärtel/Laumen/Prütting, Beweislast HdB, Band 3, § 1933 Rn. 4; Staudinger/Werner, BGB, 2017, § 1933 Rn. 10). Die Beweislast trifft denjenigen, der sich auf den Wegfall des gesetzlichen Erbrechts beruft (BGHZ 128, 125 = NJW 95, 1082; BayObLG FamRZ 92, 1349 (1350); Rpfleger 87, 358; zum Nachweis des Getrenntlebens bei einem im Wachkoma liegenden Ehegatten OLG Frankfurt NJW 02, 3033). Die Erteilung eines Erbscheins ändert an dieser Verteilung der Darlegungs- und Beweislast nichts (BGHZ 128, 125 = NJW 95, 1082; Soergel/Fischinger, BGB, 2021, § 1933 Rn. 17).
Die Aufhebungsklage des Erblassers (§ 1313 BGB) muss zu seinen Lebzeiten durch Zustellung der Antragsschrift (§§ 124, 133 FamFG) rechtshängig geworden sein. Ob der Erblasser berechtigt war, die Aufhebung der Ehe zu beantragen, ist nach §§ 1314 ff. BGB zu beurteilen. Der Aufhebungsantrag des überlebenden Ehegatten beseitigt dessen Erbrecht nicht.
praxistipp | Hier droht eine weitere Haftungsfalle: Der Wegfall des Ehegattenerbrechts wird immer aus der Sicht des betreffenden Erblassers geprüft und gilt nur für das diesbezügliche Erbrecht. Betreiben beide Ehegatten die Scheidung, verlieren beide ihre gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrechte. Stellt jedoch nur einer der Ehegatten Scheidungsantrag und verhält sich der andere passiv oder widerspricht der Scheidung, so verliert nur der Scheidungsunwillige seine gesetzlichen Erbrechte, nicht aber der Ehegatte, der das Scheidungsverfahren betreibt.
4. Tod während des laufenden Scheidungsverfahrens
Tritt der Tod eines Ehegatten während des laufenden Scheidungsverfahrens ein und liegen die Voraussetzungen des § 1933 BGB vor, wird der überlebende Ehegatte kein gesetzlicher Erbe. Er hat daher auch kein Pflichtteilsrecht.
a) Erledigung der Hauptsache
Verfahrenstechnisch gilt das Verfahren als in der Hauptsache erledigt (§ 131 FamFG). Dazu bedarf es keiner besonderen Prozesserklärungen. Handelt es sich bei der Folgesache um eine Ehewohnungs- und Haushaltssache, so gilt gemäß § 208 FamFG auch die Folgesache als in der Hauptsache erledigt. Für die übrigen Folgesachen (§ 137 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 2, 4, Abs. 3 FamFG) fehlen entsprechende Regelungen. Die Erledigung erstreckt sich aber grundsätzlich auch auf die (weiteren) Folgesachen, da hierüber nur für den Fall der Scheidung zu entscheiden ist (§ 137 Abs. 1, § 141 S. 1, § 142 Abs. 2 FamFG).
Sowohl dem überlebenden Ehegatten als auch dem Erben des verstorbenen Ehegatten kann auf Antrag vorbehalten werden, eine Folgesache als selbstständige Familiensache fortzuführen. Dabei muss der Antrag jedoch gestellt werden, bevor die Kostenentscheidung in Rechtskraft erwächst, weil hierdurch das erledigte Verfahren beendet wird.
b) Rücknahme des Scheidungsantrags durch den überlebenden Ehegatten
Zweifelsfrei kann ein Scheidungsantrag bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung zurückgenommen werden. Bei wirksamer Rücknahme des Scheidungsantrags ist zwar das Verfahren nach §§ 608, 626 i. V. m. § 269 Abs. 3 ZPO als nicht rechtshängig geworden anzusehen, mit der Folge, dass auch die Zustimmung des Erblassers zur Scheidung ihre Wirkung verliert (MüKo/Leipold, BGB, 9. Aufl., § 1933 Rn. 15; vgl. auch Soergel/Stein, BGB, 12. Aufl., § 1933 Rn. 4; Staudinger/Werner, BGB, 12. Aufl., 2017, § 1933 Rn. 5; Erman/Schlüter, BGB, 17. Aufl., § 1933 Rn. 2). Dabei berührt die Motivation für die Antragsrücknahme deren Zulässigkeit grundsätzlich nicht (vgl. dazu BGH, FamRZ 74, 648 (649)). Erfolgt aber die Rücknahme des Scheidungsantrags erst nach dem Erbfall (dem Tod des Erblassers), so hat sie keinen Einfluss mehr auf die Anwendbarkeit des § 1933 BGB (LG Tübingen, BWNotZ 86, 22; Soergel/Stein, BGB, 12. Aufl. ,§ 1933 Rn. 4; MüKo/Leipold, BGB, 9. Aufl., § 1933 Rn. 7). Hierzu führt das OLG Naumburg (30.3.15, 2 Wx 55/14) aus: „Dies ergibt sich bereits aus dem eindeutigen Wortlaut des § 1933 S. 1 BGB, wonach für die Beurteilung allein auf den Zeitpunkt des Erbfalls abzustellen ist. Nach § 269 Abs. 3 ZPO werden zwar die unmittelbaren Wirkungen der Rechtshängigkeit rückwirkend beseitigt, die Vorschrift bietet jedoch keine Grundlage für die Annahme, dass ein bereits ausgeschlossenes Ehegattenerbrecht rückwirkend wieder auflebt.“
5. Folgesache Zugewinn
Die Erben des verstorbenen Ehegatten können hingegen das Verfahren nicht fortsetzen. Nach § 1378 Abs. 3 S. 1 BGB geht ein Anspruch auf Zugewinnausgleich nur dann auf die Erben des verstorbenen Ehegatten über, wenn dieser ihn noch zu Lebzeiten erworben hat. Der Anspruch entsteht aber erst mit der Beendigung des Güterstands, also mit der Rechtskraft des Scheidungsausspruchs und nicht schon mit der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags. Zwar hat der BGH die Vorschrift des § 1384 BGB analog angewandt. Diese Vorschrift sieht aber nur den für die Berechnung des Zugewinns maßgeblichen Zeitpunkt auf die Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags vor, nicht aber den Zeitpunkt der Entstehung des Ausgleichsanspruchs nach § 1378 Abs. 3 S. 1 BGB.
Für den überlebenden Ehegatten, dem Zugewinnausgleichsansprüche zustehen, spielt § 1384 BGB jedoch eine Rolle. Hat er tatsächlich einen Anspruch auf Zugewinnausgleich gegenüber den Erben, so ändert sich auch hier der Bewertungszeitpunkt. Grundsätzlich ist der Bewertungszeitpunkt der Tag der Beendigung des Güterstands nach Maßgabe der § 1375 Abs. 1, § 1376 Abs. 2 BGB. Im Scheidungsverfahren wird dieser Bewertungszeitpunkt bekanntlich nach § 1384 BGB auf den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit vorgezogen. Stirbt ein Ehegatte, nachdem ein Scheidungsantrag erhoben worden ist, und liegen die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe vor, tritt für die Berechnung des Zugewinns in entsprechender Anwendung des § 1384 BGB an die Stelle der Beendigung des Güterstands durch den Tod des Ehegatten der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags. Wird allerdings der Zugewinnausgleich durch die Erhöhung des Erbteils verwirklicht, so kann selbstverständlich das Zugewinnausgleichsverfahren als Folgesache nicht fortgeführt werden.
- Neidinger/Rupp, § 1933 BGB – Verfassungsbedenken, Verfahrensfragen, Verbesserungsmöglichkeiten, ZfPW 20, 239
AUSGABE: EE 8/2025, S. 137 · ID: 50442525
