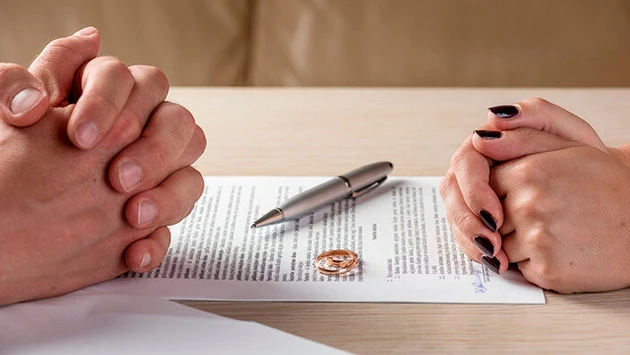Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Aug. 2025 abgeschlossen.
Feststellung des ErbrechtsDarlegungs-, Beweis- und Feststellungslast sowie Mitwirkungspflichten in erbrechtlichen Verfahren
| Als Abweichung von anderen Rechtsordnungen kennt das deutsche Recht verschiedene Verfahren zur Feststellung des Erbrechts. Jedes der Verfahren kann in einer bestimmten Konstellation vorzugswürdig sein. Welcher Weg bestritten werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Beitrag stellt die Verfahren und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Konsequenzen für das prozessuale Handeln gegenüber. |
1. Grundsätze
Zur Feststellung des Erbrechts kommen infrage:
- Die Feststellungsklage im Zivilprozess (ZPO) und
- das Erbscheinsverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).
Im Zivilprozess kann außerdem über die Erbenstellung einer Partei auf Klage und Widerklage entschieden werden. In diesen Verfahren findet die Prüfung der Erbenstellung (lediglich) „incidenter“ statt, nämlich bei der Leistungsklage im Rahmen der Prüfung eines Anspruchs des (Mit-)Erben oder gegen (Mit-)Erben, wann immer die Erbenstellung für den geltend gemachten Anspruch oder auch im Hinblick auf die Verteidigung z. B. des auf den Pflichtteil in Anspruch genommenen Erben von streitentscheidender Bedeutung ist.
Ist ein Erbschein durch das Nachlassgericht erteilt oder hat ein Prozessgericht die Erbenstellung einer bestimmten Person angenommen, stellt sich die Frage der Bindungswirkung für das jeweils andere Gericht.
Der Erbschein ist für das Prozessgericht – in welchem Verfahren es auch immer entscheidet – nicht bindend. Das lässt sich schon daraus erklären, dass ein Erbschein wieder – als unrichtig – eingezogen werden kann. Anders als die Entscheidung des Nachlassgerichts erwächst die Entscheidung des Prozessgerichts – inter partes – in Rechtskraft. Sie bindet deshalb (umgekehrt) das Nachlassgericht im Erbscheinsverfahren. Diese Bindungswirkung besteht jedoch nur innerhalb der Grenzen der (subjektiven) Rechtskraft. Ihr steht auch nicht entgegen, wenn etwa nach der Entscheidung des Prozessgerichts ein neues Testament auftaucht. Einer Feststellungsklage fehlt nicht deshalb das Rechtsschutzinteresse, weil ein Erbschein bereits erteilt ist.
Abgesehen von unterschiedlichen Kostenregelungen liegen die wesentlichen Unterschiede beider Verfahren im Verfahrensrecht (vgl. Steiner ZEV 19, 450 ff.).
a) Im Zivilprozess gelten
- der Beibringungsgrundsatz, d. h., die Parteien sind dafür verantwortlich, die für die Entscheidung erheblichen Tatsachen vorzutragen;Verfahrensmaxime verlangen aktivere Beteiligung am Verfahren
- der Verhandlungsgrundsatz, d. h., das Gericht entscheidet nur über das, was die Parteien zum Gegenstand des Prozesses machen, und es ist an den Parteivortrag und die Anträge der Parteien gebunden, § 308 ZPO;
- die Dispositionsmaxime (Verfügungsgrundsatz), d. h., die Parteien bestimmen allein, ob, in welchem Umfang und wie lange der Prozess geführt wird; sie haben die Verfügungsgewalt über den Streitgegenstand;
- die Darlegungs- und Beweislast, d. h., die Parteien müssen (grundsätzlich) die ihnen günstigen Tatsachen darlegen und beweisen; die Beweislast bedeutet dabei, dass diejenige Partei, die die ihr günstigen Tatsachen nicht zur Überzeugung des Gerichts beweisen kann, insoweit mit Vorbringen ausgeschlossen ist.
b) Im Erbscheinsverfahren gelten
- das Antragsprinzip; d. h., ohne einen entsprechenden Antrag darf das Nachlassgericht keinen Erbschein erteilen;
- der Amtsermittlungsgrundsatz, § 26 FamFG; d. h., dem Gericht obliegt die Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen von Amts wegen. Es entscheidet nach pflichtgemäßem, teilweise gebundenem Ermessen, ob es sich zur Beschaffung der für seine Entscheidung erheblichen Tatsachen mit dem Vortrag der Beteiligten begnügen kann, formlose Ermittlungen nach § 29 FamFG aufnimmt oder ob es eine förmliche Beweisaufnahme nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung (§ 30 FamFG) durchführt. Dabei bezieht sich die Pflicht zur Amtsermittlung sowohl auf die Verfahrensvoraussetzungen als auch auf die für die Sachentscheidung wesentlichen Umstände.Amtsermittlungsgrundsatz im Erbscheinsverfahren
- Die Darlegungs- und Feststellungslast; d. h., die Beteiligten müssen (grundsätzlich) die ihnen günstigen Tatsachen, auf die sie sich berufen, darlegen und glaubhaft machen bzw. nachweisen. Die Feststellungslast ist dabei gleichbedeutend mit der Beweislast im Zivilprozess und bedeutet, dass diejenigen Tatsachen, die nicht zur Überzeugung des Gerichts glaubhaft gemacht bzw. nachgewiesen sind, nicht berücksichtigt werden.
2. Darlegungs- und Beweislast im Zivilprozess
Die Darlegungslast tragen (grundsätzlich) der Kläger als Anspruchsteller für die seinen Anspruch begründenden Tatsachen und der Beklagte als Anspruchsgegner für die rechtshemmenden, rechtsvernichtenden und rechtshindernden Einwendungen und Einreden.
Welche Tatsachen darzulegen sind, bestimmt sich zunächst nach dem materiellen Recht. Wie viel dabei darzulegen ist, bestimmt sich nach den Einwendungen des Gegners.
Jede der Parteien trägt die Beweislast für die ihr günstigen Tatsachen, also der Kläger für die seinen Anspruch begründenden Tatsachen und der Beklagte für die seine Einwendungen und Einreden begründenden Tatsachen.
3. Mitwirkungspflichten (§ 27 FamFG) und Feststellungslast im Erbscheinsverfahren
a) Mitwirkungspflichten
Zwar hat das Nachlassgericht im Erbscheinsverfahren aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 26 FamFG) von Amts wegen die zur Feststellung der erheblichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen. Diese Aufklärungs- und Ermittlungspflicht besteht allerdings nach allgemeiner Auffassung lediglich insoweit, als das Vorbringen der Beteiligten und der Sachverhalt als solcher bei sorgfältiger Prüfung hierzu auch Anlass geben (BGHZ 184, 269).
Die Parteien trifft gem. § 27 Abs. 1 FamFG eine sog. Mitwirkungs- und Verfahrensförderungslast. Sie haben durch eingehenden Tatsachenvortrag an der Aufklärung mitzuwirken. Ihrer Mitwirkungs- und Verfahrensförderungslast kommen sie nach, wenn ihr gesamter Vortrag und die Bezeichnung geeigneter Beweismittel dem Gericht Anhaltspunkte dafür geben, in welche Richtung es seine Ermittlungen durchführen soll (OLG Hamm FamRZ 25, 199). Die Verpflichtung des Gerichts zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts findet dort ihre Grenze, wo es die Verfahrensbeteiligten allein oder hauptsächlich in der Hand haben, die notwendigen Erklärungen abzugeben und Beweismittel zu bezeichnen bzw. vorzulegen, um eine ihren Interessen entsprechende Entscheidung herbeizuführen (OLG Düsseldorf NJW-RR 13, 782).
Damit nähern sich die Obliegenheiten in nachlassgerichtlichen Verfahren denjenigen, die die Parteien nach dem Beibringungs- oder Verhandlungsgrundsatz haben (Zöller/Greger, ZPO, 35. Aufl. 2024, Vorbemerkungen zu §§ 128–252 Rn. 10 – 10b), ohne diese jedoch zu erreichen.
merke | Im nachlassgerichtlichen Verfahren kommt es damit entscheidend auf die Frage an, ob die im Einzelfall vorgetragenen oder dem Nachlassgericht auf anderem Weg bekannt gewordenen Tatsachen zur Veranlassung einer Beweisaufnahme ausreichen (oder nicht). Die Beteiligten sind deshalb gehalten, so substanziiert vorzutragen, dass sie gemäß § 2358 Abs. 1 BGB dem Nachlassgericht Anlass zu Ermittlungen von Amts wegen geben (OLG Düsseldorf FamRZ 14, 69).
b) Feststellungslast
Die im Zivilprozess aus der Darlegungslast folgende Beweislast hat im nachlassgerichtlichen Verfahren eine Parallele, weil auch dort derjenige Beteiligte, der eine bestimmte Rechtsfolge geltend macht, den Nachteil der Unaufklärbarkeit (non liquet) tragen muss. Man spricht dann allerdings nicht von Beweis-, sondern von der Feststellungslast bzw. einer nur objektiven (nicht formellen) Beweislast (BeckOK FamFG/Perleberg-Köbel, 54. Ed. 2025, § 37 Rn. 18–23).
4. Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen
a) Beweislastregel
Eine abweichende gesetzliche Beweislastregelung ordnet im Bereich des Erbrechts die Bestimmung des § 2336 Abs. 3 BGB zum Beweis des Grundes der Entziehung des Pflichtteils an.
b) Gesetzliche Vermutungen
Gesetzliche Vermutungen für das Vorliegen von Tatsachen ordnen für den Bereich des Erbrechts an:
- § 2009 BGB als Vermutung für die Vollständigkeit des Nachlassverzeichnisses;
- § 2255 S. 2 BGB als Vermutung für die Absicht der Aufhebung eines Testamentes, wenn der Erblasser die Testamentsurkunde vernichtet oder in der bezeichneten Weise verändert hat;
- § 2365 BGB als Vermutung für die Richtigkeit eines erteilten Erbscheins und
- § 2368 i. V. m. § 2365 BGB als Vermutung für die Richtigkeit des erteilten Testamentsvollstreckerzeugnisses.
Die Folge des Bestehens einer gesetzlichen Vermutung ist, dass diejenige Partei oder derjenige Beteiligte, der die Vermutung für sich in Anspruch nehmen will, die Voraussetzungen der Vermutung darzulegen und ggf. zu beweisen, der Gegner alsdann die Vermutung zu widerlegen hat.
Fehlen gesetzliche Beweislastregeln oder Vermutungen, gilt zunächst die Grundregel, dass der Anspruchsteller die anspruchsbegründenden Tatsachen und der Anspruchsgegner die Tatsachen der rechtshemmenden, rechthindernden und rechtsvernichtenden Einreden und Einwendungen beweisen muss (BGH NJW-RR 98, 1268). Daneben ist eine Vielzahl von Einzelfällen zu beachten, in denen die vorgenannte Grundregel nicht greift und auf die Rechtsprechung zurückgegriffen werden muss (vgl. ausführlich: Zöller/Greger, ZPO, 84. Aufl. 2025, Vorb. zu § 284 Rn. 19 – 21).
Unter Berücksichtigung der hier dargestellten sowie weiterer Gesichtspunkte gibt die folgende Checkliste eine Orientierung zur Wahl des Verfahrens:
Checkliste / Auswahl des Verfahrens zur Feststellung des Erbrechts |
|
AUSGABE: EE 8/2025, S. 133 · ID: 50442526